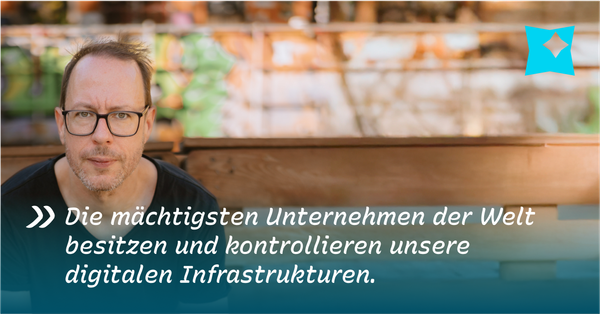Trump-Schutzschirm wirkt: EU-Kommission suspendiert Kartellverfahren gegen Google – und schadet damit dem fairen Wettbewerb in Europa
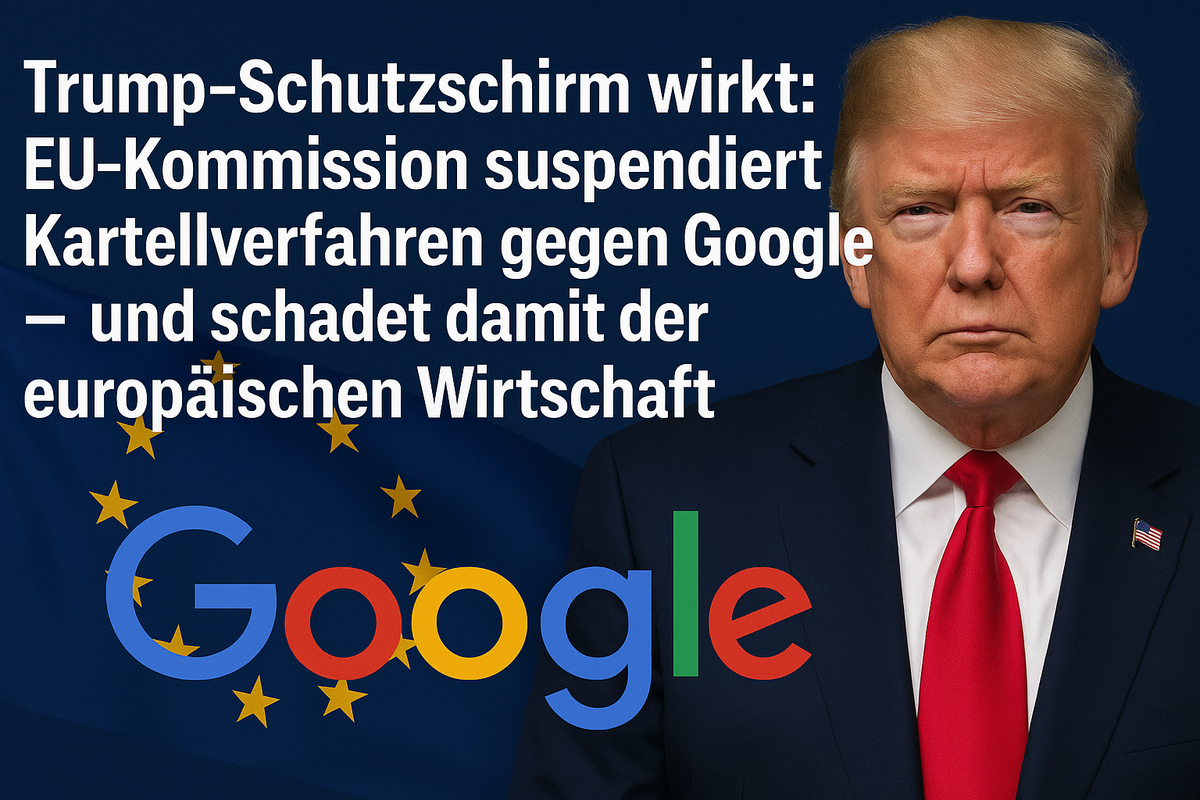
Die Entscheidung der EU-Kommission, ob Google gegen europäisches Wettbewerbsrecht verstoßen hat, war eigentlich für Anfang September erwartet worden. Im Kern geht es um die Frage, ob der US-Konzern Alphabet den Markt für Internetwerbung dominiert und seine Macht missbraucht hat (Art. 102 AEUV). Die europäischen Verträge wollten genau das verhindern: dass Monopolisten das Prinzip von Angebot und Nachfrage aushebeln und damit fairem Wettbewerb schaden. Der Vorwurf lautet, dass Google mit Produkten wie AdExchange eine marktbeherrschende Stellung bei Schaltung und Vermittlung von Internet-Werbebannern aufgebaut hat, Preise und Bedingungen diktieren kann sowie Konkurrenten gezielt aufkauft und vom Markt verdrängt. In einem monopolisierten Markt setzen sich nur noch die Produkte des Platzhirsches durch – unabhängig davon, ob sie wirklich die besten oder günstigsten sind.
Das Verfahren nach Art. 102 AEUV wurde bereits 2021, also noch vor Inkrafttreten des Digital Markets Act (DMA), eröffnet. 2023 übermittelte die Kommission Google ihre vorläufige Rechtsauffassung. Nun sollte das Verfahren abgeschlossen werden – doch offenbar hat die Kommissionsspitze kurzfristig eingegriffen und den Abschluss gestoppt. Das berichtet der Branchendienst MLEX mit Verweis auf interne Quellen in der EU-Kommission.
Hier entsteht ein gefährlicher Präzedenzfall
Noch vergangene Woche berichtete Reuters, dass – anders als zunächst erwartet – keine Zerschlagung von Googles Werbesparte angeordnet werde, sondern allenfalls ein eher moderates Bußgeld. Doch nun wurde selbst dieser Schritt auf höchster Ebene blockiert. Ob das Verfahren endgültig eingestellt oder nur auf unbestimmte Zeit verschoben ist, bleibt offen. Klar ist: Die Fachabteilung der Kommission wurde von ganz oben ausgebremst. Hintergrund ist Googles monopolartige Dominanz im Markt für Werbebanner, wo der Konzern die Spielregeln von Angebot und Nachfrage zum eigenen Vorteil verzerrt.
Der Grund für den plötzlichen Stopp liegt offenbar weniger in der Sache selbst als in der Politik. Wegen des andauernden Handelsstreits mit US-Präsident Donald Trump will die Kommission offenbar vermeiden, einen Anlass für neue Zölle oder gar persönliche Sanktionen gegen EU-Beamte zu liefern. Was hier geschieht, ist ein gefährlicher Präzedenzfall: Wenn die Durchsetzung geltenden Rechts zum politischen Faustpfand wird, geraten Demokratie und Rechtsstaat unter Druck.
Wer trifft die Entscheidung im Hintergrund?
Wer die Entscheidung zu verantworten hat, ist bislang unklar. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen oder die zuständige Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera? Auffällig ist: Noch am 1. September bekannte sich Digitalkommissarin Henna Virkkunen in einem offenen Brief an den US-Abgeordneten Jim Jordan ausdrücklich zur souveränen Durchsetzung des EU-Rechts („I will keep enforcing them, for our kids, citizens and businesses“). Wollte sie dadurch auch zum Ausdruck bringen, dass die Entscheidung über ihren Kopf hinweg getroffen wurde?
Juristisch gilt ein Wettbewerbsverstoß durch Google als wahrscheinlich. Zu offensichtlich ist die Dominanz im Bereich der Werbebanner, verstärkt seit der Übernahme des Konkurrenten DoubleClick im Jahr 2008. Auch in den USA kam ein Bundesgericht im Frühjahr zu dem Schluss, dass Google im Markt für Display Ads („open-web digital advertising market“) eine rechtswidrige Monopolstellung aufgebaut und missbraucht hat. Da Wettbewerbsverstöße in den USA in einem zweistufigen Verfahren nach dem Sherman Act verhandelt werden, wird die Frage, welche Rechtsfolgen ein Verstoß hat, separat verhandelt. Das Verfahren zu der Frage, ob Google zerschlagen wird, sein Geschäftsmodell ändern muss oder Bußgelder erhält, will das US-Bundesgericht offenbar noch in diesem Monat eröffnen. Möglich also, dass Brüssel bewusst abwartet, bis die US-Justiz zuerst entscheidet. Damit läge der vermeintliche „Angriff“ auf die Tech-Giganten nicht in Europa, sondern in der von Donald Trump ohnehin verhassten unabhängigen US-Justiz.
Konstruktionsfehler: Handel schlägt Durchsetzung
Dass die Kommissionsspitze überhaupt in der Lage ist, Verfahren dieser Tragweite politisch zu stoppen, liegt an einer Konstruktionsschwäche der wettbewerbsrechtlichen Aufsicht, vor der Kritiker seit Jahren warnen und die auch der Digital Markets Act (DMA) nicht behoben hat. Während das EU-Recht nationale Wettbewerbshüter wie das Bundeskartellamt dazu verpflichtet, unabhängig zu arbeiten, ist die EU-Wettbewerbsaufsicht direkt in die Weisungskette der Kommission eingebunden. Was auf nationaler Ebene rechtswidrig wäre – eine Ministerin, die in laufende Verfahren eingreift – ist auf EU-Ebene also erlaubt. Genau hier zeigt sich das demokratietheoretische Problem: Die Kommission verhandelt einerseits mit den USA über Handelsfragen und ist gleichzeitig für die Durchsetzung des Wettbewerbsrechts zuständig. Im schlimmsten Fall werden Autozölle gegen Demokratie und Rechtsstaat eingetauscht. Dass der Gesetzgeber keine unabhängige Digitalagentur auf EU-Ebene geschaffen hat, wie es digitalpolitische Expert:innen stets gefordert haben, rächt sich nun.
Durchsetzung der Plattformregulierung funktioniert - nur nicht gegen US-Unternehmen
Dass die EU-Regeln für einen fairen Wettbewerb durchaus durchsetzbar sind, hat Brüssel in den vergangenen Monaten bewiesen – gegen Pornoplattformen und auch gegen TikTok. Nur die großen US-Plattformen werden auffällig geschont, seitdem sie sich unter den politischen Schutzschirm Donald Trumps gestellt haben. Eine unabhängige Digitalagentur in der EU hätte sich bei der Rechtsdurchsetzung von solchen politischen Überlegungen und willkürlichen Differenzierungen nicht leiten lassen.
Mit Blick auf unsere digitale Zukunft ist das Wettbewerbsrecht kein Nebenschauplatz. Er soll europäische Verbraucher:innen schützen und fairen Wettbewerb sichern. Wenn wir Monopolisten nicht in die Schranken weisen, gefährden wir auch die europäische Digitalwirtschaft – ihre Geschäftsmodelle scheitern längst an den Markthürden, die Big Tech aufgebaut hat. Wenn die EU-Kommission jetzt die Hände in den Schoß legt, ist das ein fatales Signal für jegliche Bemühungen um digitale Souveränität und Innovationen „made in Europe“. Die konsequente Durchsetzung demokratischer Regeln darf nicht zur Verhandlungsmasse werden. Auch dann nicht, wenn das Donald Trump und den US-Technologiekonzernen nicht gefällt.
Diese Analyse habe ich zusammen mit Michael Kolain für das Zentrum für Digitalrechte und Demokratie geschrieben.